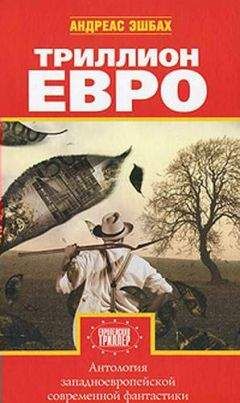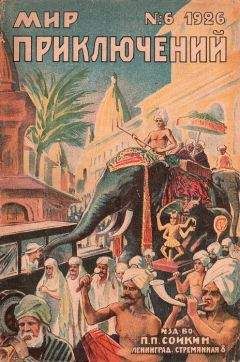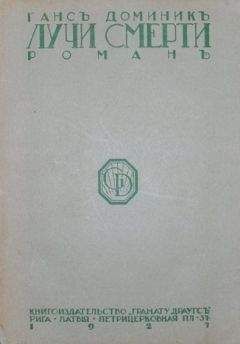Scott Robert Becker aus dem Bundesstaat Kansas hat sich laut Fernsehberichten kurz nach der Geburt des Mädchens April von der Mutter scheiden lassen und dabei sein Kind aus den Augen verloren. Wenig später besann er sich aber und startete eine Suche nach seiner Tochter, die erst jetzt dank Internet zum Erfolg führte. In einem Restaurant in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia schlossen sich Vater und Tochter vergangene Woche in die Arme. Auch April suchte seit geraumer Zeit ihren Vater und surfte viele Male erfolglos im Internet. Bis ihr dann die Idee kam, dass ihr Vater nach ihr suche, die Suchmaschine mit» Scott Robert Becker sucht April «zu füttern. Sofort stieß sie auf die von ihrem Vater eingerichtete Internetseite: Liebe April, wenn Du das liest, bitte schicke mir eine E-Mail. Ich bin Dein Vater und möchte so gern mit Dir reden. Die in Georgia lebende April Antoniou ist inzwischen Mutter zweier Kinder im Alter von vier und sechs Jahren.
UND IM VERLAUF der Adoption klopfen immer neue Muttersehnsüchte an meine Pforte. Ich bin das brave Adoptionskind und wende mich von der Adoptionsfamilie ab. Außer der Großmutter, die eine starke Anziehungskraft auf mich ausübt, die mich nicht abschreckt, mir das Kochen beibringt, habe ich niemanden mehr. Vorher war da das Kinderheim, die lose Gemeinschaft der Verlorenen. Jetzt sind da die Großmutter und deren Unterdrückung im Haus, denn auch sie ist nur geduldet, angehalten, sich zu beschäftigen. Sie gewinnt mich als ihren Anhänger, weil es ihr nicht anders geht als mir. Ich nehme sie nicht als Mutterersatz an. Ich kann mir vorstellen, wie es ist, eine Oma zu haben. Ich trete zu ihrem Denken über. Was die Adoptionsmutter mit mir unternimmt und sich an Aufgabenstellung ausdenkt, lerne ich auswendig, übe ich ein. Und entwickle gleichzeitig den Wunsch, das Adoptionshaus so schnell als möglich wieder zu verlassen.
wir alle, die wir träumen und denken;
wir schließen Bilanz, und der unsichtbare Saldo spricht immer gegen uns.
MAN BESCHIMPFT MICH NICHT. Ich werde unterwiesen, auf einen Missstand aufmerksam gemacht und sehe mich freundlich angehalten, ohne Widerrede zu verrichten, den Anweisungen zu folgen, nach dem Sinn nicht zu fragen. Ich bin kein Heimkind, bin Dorfkind, habe gewisse Dinge zu tun und Spaß an dem zu haben, was sie für mich mit mir unternehmen. Der Pöbel soll unter seinesgleichen bleiben, nach der Pfeife des Mobs selig und verloren tanzen. Der allgemeinen Gesellschaft und ihren schamlosen Vergnügungen gegenüber ist Vorsicht geboten, Gewöhnlichkeit und Vulgarität sind abzulehnen. Ich bin ein Maskenkind. Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut, und hätte er nicht drei Ecken, so wäre es nicht mein Hut. Die Großmutter unterrichtet mich in Grundlagen. Ich bin ihr aufmerksamer Schüler und bald aufs Beste von ihr unterwiesen, was Grüne Klöße aus Mehl und Stärke, Kartoffelbrei mit Sauerampfer anbelangt, Kalbsnierenbraten, Forelle, Aal in Gelee. Sie weckt mich vor dem allgemeinen Aufstehen: Heute ist Aaltag, Junge rasch. Sie übergibt mir die Börse, die Tragetasche. Ich eile durch die Vormorgennacht zum Fischerlandesteg, wo sie Donnerstag immer dünne, zum Räuchern ungeeignete Aale kiloweise gegen ein geringes Geld feilbieten. Nimm so viel, wie sie dir geben, mahnt die Großmutter. Ich reiche dem Fischverkäufer den Beutel hin. Er lässt hinterm Verkaufstisch die Strippen genannten dünnen Aale in die Extratragetasche aus derbem wasserundurchlässigem Material verschwinden. Gibt es schon wieder Aal in Gelee bei euch, auch gut, und grüß mir deine Oma schön, sagt der Fischer, reicht mir die Beutel. Kein leichtes Unterfangen, die schwere, lebendig wabernde Aalstrippentragetasche den Weg zurück zu schleppen. Gewicht ist ein anderes Wort für Gravitationskraft, jene Kraft, mit welcher ein Körper, in diesem Fall meine Tragetasche voller Aale, von der Erde angezogen wird. Das Gewicht ist an der Balkenwaage ablesbar. Meine jungen Arme bekommen die Gravitationskraft mit zunehmendem Weg immer stärker zu spüren. Ich muss die Tasche abstellen, Hand und Arm ausschütteln. Immer öfter die Hände abwechseln. Immer häufiger anhalten, ausruhen, anheben, den Zappelbeutel vorwärtstragen. Aus dem Tragen wird ein wehes Schleppen. Zum Schluss möchte ich den Beutel ziehen, schleifen, stehen lassen, die Last los sein. Und habe nach dem Durchatmen neuen Mut zu fassen, mich zu überwinden. Die Großmutter wartete.
Das Meer befindet sich am Ende der Straße, hinter dem kleinen Park, unterhalb der zehn bis zwölf Meter hohen Steilküste. Ich mühe mich ab und muss an den kleinen Strandläufer denken, der unbelastet am Strand entlangläuft, nach Nahrung pickt und unbesorgt lebt und keinen Einkaufsbeutel kennt und nichts von der Prozedur weiß, die meine Aale daheim erwartet. Da ist die Großmutter, die mich tapfer nennt, lobt, mir die Tasche abnimmt, jedes Mal: Feine Dinger, ach und wie die erst schmecken werden, sagt. Ich trete scheu neben sie hin, halte gebührenden Abstand zum Küchentisch, der ein Möbel mit ausziehbarem Unterteil ist, in der Zugvorrichtung zwei Emailleschüsseln eingepasst, tief wie die Sandlöcher, die wir Kinder mit unseren Händen am Strand graben, um die Wasser von unten zu locken, uns die Grube zu füllen. Die beiden Schüsseln sind in kreisrunde Aussparungen eingepasst. Der Tischbelag ist an einigen Stellen rissig. Kleine Löchlein entstehen. Risse und Löcher bilden mit der Gaze im Wachstuch ein besonderes Dekor. Es erinnert an alte Kunst, Ölgemälde alter Meister. Vertrocknete Einzelstücke verlieren den Halt, lösen sich, geben die Gemeinschaft auf, hinterlassen Lücken. Die Großmutter repariert die Oberfläche mit Tapetenleim und Zeitungspapier.
Und dann geht alles grausam schnell. Der Tüteninhalt wird in die Schüssel gekippt, die Aalmenge zu gleichen Hälften über beide Behältnisse verteilt und augenblicklich mit Salz bedeckt. Salz mit vollen Händen ausgestreut, worauf die Aale lebendig werden. Ruckzuck ist die Ausziehvorrichtung zuzuschieben, dass die sich wild aufführenden Aale nicht über den Schüsselrand springen und das Weite in der Küchenenge suchen, über den Küchenfußboden unter den Küchenschrank flüchten, wo sie schwer zu fassen und nur mit dem Besenstiel herauszuholen sind. Die dünnen Aale hämmern mit Kopf, Leib, Schwanz gegen die Tischplattenunterkante. Das geht eine lange Weile so zu. Minutenlang findet dieser Todeskampf statt. In Wellen aufflackernd, in Wellen abflachend, von Tönen begleitet, die heute noch Horror für mich sind, ein ungutes Glucksen, ein elendiges Zutschen und Klatschen; mit jeder fortlaufenden Minute schwächer werdend, nicht zu beschreiben, verhallt dann das Todesröcheln. Und hat es aufgehört, wird der Tisch wieder ausgezogen, ist da dieser Brei aus Schaum, Blasen, Schleim und Salzpartikeln zu sehen, der alle toten Kadaver überzogen hat. Ein hässlicher Schlamm, voller letzter Energie und Kraft der sich im Tode windenden Aale, der dem Kind im Kopfe bleibt, ihm für den Moment selbst die Großmutter verleidet. Schaum, der sich mir wie eine Tätowierung ins Hirn gebrannt hat, wie die zu Bergen getürmten Kinderschuhe, das viele Kopfhaar und die Brillengestelle im Konzentrationslager, das wir auf Klassenfahrt besucht.
Auch wenn die Adoptionsmutter mich als ihren Erben eingesetzt und darauf wieder enterbt hat, wenn ihr mein Tun nicht recht gewesen war, ich ihrer Ansicht nach falsch gehandelt, mich als unwürdig erwiesen habe, den mir zu meinem achtzehnten Geburtstag aus Freude darüber, als Lehrerstudent genommen worden zu sein, versprochenen Wartburg Modell 5 3 5 in Rot-Weiß, habe ich nicht mehr annehmen müssen, bin dafür lieber um die Ecke in die Metallfabrik gegangen. Das schwerste Gewicht fällt als Erstes aus der Reihe, wenn die Dinge erst in Bewegung geraten, Schieflage aufkommt. Das schwerste Stück kippt zuerst auf die schiefe Ebene. Ich habe nicht Lehrer studiert, wie es die Adoptionseltern wünschten. Ich bin nicht nach Greifswald auf die Universität gegangen. Ich bin geflohen. Ich habe Hackenstaub erzeugt und bin in eine Lehre gegangen, unter lauter junge Menschen, vier, fünf Jahre jünger als ich. Ich bin an der Kunsthochschule untergekommen und bin dort in die Bibliothek geflohen. Ich habe diesen Schaum gesehen. Ich sah diese Kadaver in ihm. Das alles zusammen hat mich zeitlebens nicht nur nicht mehr losgelassen, sondern vertrieben, motiviert, mich Schriftsteller werden lassen und ist, was mich weiterhin antreibt, Orte wie Szenen und Hemden zu wechseln. Ich bin der Flüchtende, dem bewusst wird, dass er ein ewiger Flüchtling ist, von der Ostseeküste ins Vogtland abgehauen.
PILZE SUCHEN sollte besser Pilze finden heißen, weil beim Suchen von Pilzen das Finden von Pilzen das Suchen von Pilzen belohnt, das Suchen nicht das wahre Ziel ist, sondern der Zweck zum Finden, der die gefundenen Pilze heilige, nicht die nicht gefundenen Pilze. Suchen ohne Finden ist herzergreifend unerfreulich. Erst das Finden belohnt den Suchenden. Man soll finden; es soll gefunden werden; es ist nicht vorzuweisen, was nicht gefunden wird. Das Finden des Dinges an sich erst bringt dem Suchenden Erlösung. Der Suchende soll finden. Finderfreude sei ihm Ansporn, Lust erweckende, vorwärtstreibende Motivation. Ist ein Ding gefunden, sucht der Finder wieder und wieder fündig zu werden. Finden wird Sucht. Der Suchende wird suchsüchtig. Wo sich ein Pilz findet, sagt der Adoptionsvater auf der Friedhofswiese, hält zu seinen Worten den ersten Birkenpilz hoch erhoben, findet sich die gesamte Pilzfamilie ein. Wir kreisen in spiralförmiger Pirsch um die Birkenbäume. Wir ernten die anverwandten Pilze. Der Pilzkorb ist gut gefüllt. Es geht zurück ins Dorf. Suchen heißt finden, sagt der Pilzsammler auf dem Rückweg, rät mir, diesem hohen Motto zu folgen. Es wird mich durchs Leben leiten. Der Pilzsammler ist mein Adoptionsvater. Er ist Mathematiklehrer. Es sind Ferien. Er ist ein wortkarger Mann. Er redet vor der Klasse an der Tafel, redet nicht viel. Er liest die Zeitung von hinten nach vorne. Er knickt die Zeitungsseiten um. Er spielt nach dem Zeitungslesen mit sich Schach. Schwarz gegen Weiß, Weiß gegen Schwarz. Die Adoptionsmutter sagt von ihm, dass er ein Schachgenie sei. Sie hat keine Ahnung von Schach. Der Adoptionsvater lässt sich das Gerede vom Schachgenie gefallen, er ruckt unmerklich die Schultern, winkt innerlich gütig ab. Er ist mein Adoptionsvater. Er ist sechsundfünfzig Jahre alt. Er könnte vom Alter her mein Großvater sein. Wenn er mein Großvater wäre, würde mich sein Schweigen nicht stören. Ich würde das Schweigen gut finden und nicht dauernd versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Wir haben wenig miteinander gemein. Erst wenn Pilzzeit ist, sieht man uns zusammen zum Ort hinaus die Landstraße entlang zum Friedhof am Ortsrand gehen. Kurz vor dem Friedhof schlägt der Adoptionsvater Haken, die eventuelle Verfolger erfolgreich abschütteln sollen. Ich schaue mich oft um. Es folgt uns nie einer. Man soll seine Stellen geheim halten, sie mit ins Grab nehmen, hat der Adoptionsvater einmal gesagt. Wenn man niemanden hat, sein Geheimnis keinem anvertrauen kann, soll man es für sich behalten und sich sagen: Einer wird kommen, nichts suchen und doch finden. Der Adoptionsvater sammelt leidenschaftlich Pilze. Der Adoptionsvater kennt Stellen, die nur ihm bekannt sind, sonst keinem. Der Himmel, die Winde, die Birken und einige Fliegen, Kaninchen, Vögel wissen von mir und dem Adoptionsvater, wissen von den Birkenpilzfamilien, von Opa Pilz und Oma Pilz und deren Pilzkinder und Kindeskinder der großen Pilzfamilie. In dem einzigen Urlaub mit dem Adoptionsvater und der Adoptionsmutter besuchen wir das Elbsandsteingebirge, finden bei einem Spaziergang einen Wald voll mit Pilzen. Der Pilzfreund fühlt die Nähe der Pilze mit den Nasenflügeln, es gibt einen symptomatischen Gesichtsausdruck an ihm, der positiv gesprochen nichts Gutes verheißt; wir müssen uns auf eine groß angelegte Suchaktion gefasst machen; die Adoptionsmutter findet es schade, aus und vorbei ist es mit der Wanderherrlichkeit. Alles vorbei. Am Abend sind die gefundenen Pilze zu reinigen, in schmale Streifen zu schneiden, auf Fäden zu fädeln und quer durchs Zimmer zu hängen. Ich ziehe den Pilzen ihre Häute ab. Die Adoptionsmutter zerschneidet die Pilze, legt die Filets auf das Papier der ausgelesenen Zeitungen. Der Adoptionsvater sitzt am Schachbrett, als wäre kein Urlaub. Er spielt wieder einmal gegen sich. Er hat mit uns nichts zu tun. Ihn gehen die Pilze nichts an. Er hat gefunden, den Rest besorgen seine zwei Mohren. Die Wanderung ist keine geworden. Der Wanderweg wurde abgebrochen. Ich habe mir die rechte Wange zerkratzt. Es sind so viele Spinnweben im Wald. Ich kämme mir das Haar frei von den Weben.
Name des Kindes
Das Kind erhält den Familiennamen des Annehmenden. Nimmt ein Ehepaar ein Kind an, erhält es den Familiennamen der Ehegatten. Auf Wunsch des Annehmenden kann das Kind einen weiteren Vornamen erhalten. Das Organ der Jugendhilfe kann in besonderen Fällen bewilligen, dass das Kind seinen bisherigen Familiennamen behält.
WAS ICH DUNKEL am Horizont auf mich zukommen sehe, lässt sich eines Tages nicht mehr abwenden. Ich habe meinen Nachnamen gegen den der Adoptionsgewaltigen einzutausehen. Ich soll meinen angestammten Nachnamen hergeben und darf nicht mehr gerufen sein, wer ich gewesen bin. Ich sehe mich wie Cassius Marcellus Clay, Sohn eines Malers in Louisville, Kentucky und als Clay und Superboxer in der Welt bekannt geworden, gezwungen, einen anderen Namen anzunehmen. Der Mann, der in Rom olympisches Gold im Halbschwergewicht geholt hat und nicht länger Clay heißen will, sondern Muhammad Ali, tauft sich selber und freiwillig um. Ich aber habe meinen Nachnamen wie einen geklauten Gegenstand abzugeben und werde mein Leben lang nicht wieder Kong Fu-Runkel und Ritter Runkel von Rübenstein gerufen, auch wenn sie mich damit im Heim und in der Klasse gehänselt haben. Es ist ein Schnitter, heißt der Tod, hat Gewalt vom großen Gott, heut wetzt er das Messer, es schneidt schon viel besser, bald wird er drein schneiden, wir müssens nur leiden, hüt dich, schönes Blümelein. Ich stehe im dunklen Wohnzimmer der Adoptionseltern, die Großmutter werkt in der Küche. Der Adoptionsvater sitzt hinterm Schachbrett, die Adoptionsmutter sitzt ihm zur Seite, sagt freudig: Ja also, und es folgt die kurze Erklärung, dass nicht bleibt, was ist, und nichts für immerfort eingerichtet ist auf Erden, vor allem so ein Nachname bei einem Heimkind, viel hunderttausend ungezählt, was unter die Sichel fällt, rot Rosen, weiß Lilien, beide wird er austilgen, ihr Kaiserkronen, man wird euch nicht schonen, hüt dich schönes Blümelein. Ich möchte die Adoptionsmutter, den Adoptionsvater Mam and Dad nennen, wie ich das in einem Kinofilm aufgeschnappt habe. Ich weiß nur allzu gut, ich werde damit nicht durchkommen, trutz Tod, komm her, ich furcht dich nit, komm her und tu ein Schnitt; wenn er mich verletzet, so werd ich versetzet, ich will es erwarten, im himmlischen Garten, freu dich, schönes Blümelein. Also höre ich zu und bereite mich vor, sage auf die Frage, wie ich denn zukünftig die Adoptionseltern rufen möchte, dass ich sie Mam and Dad heißen will, worauf eine schwere Pause entsteht. Die Adoptionsmutter ist außer sich und sichtlich verwirrt, ihr geht der Atem aus, sie schaut zum Adoptionsvater hin, so fragend ihr Blick wie der Blick nur sein kann. Mamm gesprochen und Dett wie Dad aus dem Englischen, kläre ich beflissen auf. Umsonst. Der Adoptionsvater rückt an seinem Stuhl, die Adoptionsmutter ist zur Stube hinaus und weilt für kurz im Flur, um dann schmetternd mit: Mammdett kommt nicht in Frage, zu erscheinen und mit Begriffen wie Hirngespinst, Nichtganzdichtimkopf und Wosindwirdenn jeden weiteren Disput abzuwürgen. Was heut noch grün und frisch da steht, wird morgen weggemäht, die edel Narzissen, die englischen Schlüsseln, die schön Hyazinthen, die türkischen Binden, hüt dich, schönes Blümelein. Ich argumentiere aussichtslos mit The Mamas and the Papas, die zu der Zeit an der Spitze meiner Topbands des Jahres stehen, summe California Dreaming, den damals sehr bekannten Ohrwurm, und Monday Monday, um zum zweiten nach dem ersten vergeblichen Versuch Mama und Papa als meinen zweiten Vorschlag einzureichen. Mama und Papa klingt den beiden genauso kalt und befremdlich, als hätte der Sohn mit den Seinen nichts zu schaffen. Behüt dich, Kind. Vati und Mutti soll es sein, entscheidet die Adoptionsmutter, und ich kann da maulen, wie ich will, anführen, dass alle Kinder, die ich kenne, ihre Eltern Vati, Mutti nennen. Eben drum, triumphiert die Adoptionsmutter, klug ist, wer sich nicht über die allgemeine Norm erhebt. Und also habe ich Mam and Dad wie Mama und Papa zu lassen, mir bleibt nichts weiter übrig, als gegen meine tiefen, innersten Wünsche Vati und Mutti zu akzeptieren, der Vernunft und allgemein üblichen Geflogenheit ein Okay zu geben. Tonlos höre ich mich Einverständnis geben, ziehe als Verlierer von dannen, fühle mich unterlegen, bringe den neuen Nachnamen stets mit meiner ersten Niederlage in Verbindung. Rock ist weg, Stock ist weg, liegst im Dreck, jeder Tag war ein Fest, jetzt haben wir die Pest, nur ein großes Leichenfest, das ist der Rest, leg nur ins Grab dich hin, oh du lieber Augustin, alles ist hin. Aber Gretel weinet sehr, hat nun keinen Hansel mehr, ich kriege Muttivati nicht leicht über die Lippen, kann die Adoption lang nicht Vati und Mutti zu den beiden Adoptionsoberen sagen; es widerstrebt mir, im Kopfe Vati und Mutti zu denken. Und um mich herum heißt es: Grüß uns fein die Mutti und Du hilfst Deinem Vati hoffentlich sehr.